
Der Wasserverbrauch in Deutschland
Neben dem täglichen, personenbezogenen Wasserverbrauch, der in deutschen Haushalten zwischen 122 und 126 Litern pro Person liegt, spielt auch der Wasserbedarf eine Rolle, der für die Herstellung von Lebensmitteln, Kleidung und anderen Alltagsgütern benötigt wird. Dieser als indirekter Wasserverbrauch bezeichnete Anteil entsteht in der Regel außerhalb des eigenen Haushalts und oft außerhalb Deutschlands. Wenn diese verborgenen Wassermengen zum täglichen Pro-Kopf-Verbrauch addiert werden, ergibt sich der sogenannte Wasserfußabdruck. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sich der Wasserverbrauch im Detail zusammensetzt, welche Rolle direkter und indirekter Verbrauch spielen und wie der Wasserfußabdruck als Maß für den tatsächlichen Ressourcenbedarf dient.

Zentrale und dezentrale Warmwasserbereitung im Vergleich
Vor dem Hintergrund der Wärmewende spielt die Art der Trinkwassererwärmung eine entscheidende Rolle in Hinsicht Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene und Wirtschaftlichkeit. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Wahl des Energieträgers: Während die Warmwasserbereitung mit fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl zunehmend kostenintensiver wird, bieten Heizanlagen mit erneuerbaren Energien in Kombination mit modernen Technologien zur Trinkwassererwärmung eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative. Weiterhin wächst mit zunehmender energetischer Sanierung von Bestandsgebäuden sowie bei modernen Neubauten der Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung am Gesamtwärmebedarf eines Gebäudes. Ob zentrale oder dezentrale Warmwasserbereitung: Eine Entscheidung, die sowohl bei Neubauprojekten als auch bei der Modernisierung bestehender Gebäude individuell zu betrachten ist, da beide Systeme spezifische Vorteile und Herausforderungen hinsichtlich Komfort, Energieverbrauch, Installation und Betriebskosten bieten.
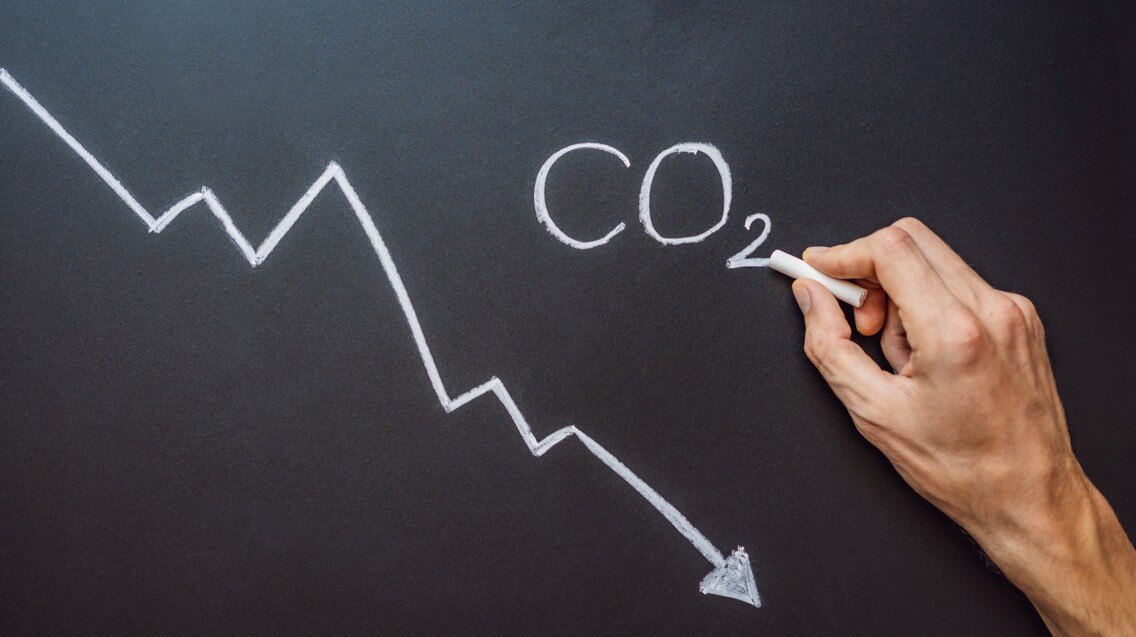
Gebäude als CO2-Senken zur Klimastabilisierung
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Ab 2050 sollen sogar negative Treibhausgasemissionen erzielt werden. Das bedeutet, dass langfristig mehr Kohlenstoffdioxid (CO₂) gespeichert wird, als in die Atmosphäre gelangt. Während die Treibhausgasemissionen für Heizen, Kühlen und Beleuchten gesenkt wurden, steigen sie im Bausektor weiter an. Eine Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen und der Umstieg auf erneuerbare Energien allein reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Eine weitere globale Strategie zur Klimastabilisierung besteht darin, Kohlendioxid langfristig zu speichern, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Dabei bietet nicht nur der Industriesektor, sondern auch die Bauwirtschaft großes Potenzial, als sogenannte CO₂-Senke zu fungieren.

Künstliche Intelligenz (KI) für Wärmepumpen
Die Wärmepumpen der neuen Generation sind da: KI-gesteuerte Systeme steigern die Energieeffizienz und senken die Energiekosten um 5 bis 13 %. Dies belegen Simulationsergebnisse des Fraunhofer ISE (Institut für Solare Energiesysteme), die im Zeitraum von September 2021 bis August 2024 durchgeführt wurden. Mit dem Einsatz noch fortschrittlicherer KI-Methoden könnten zukünftig sogar bis zu 20 % Energieeinsparung und eine entsprechende Reduzierung der CO2-Emissionen erreicht werden. Erfahren Sie in diesem Beitrag mehr über die Funktionsweise intelligenter Wärmepumpen, die durch dynamische Anpassung nicht nur den Energieverbrauch optimieren, sondern auch den Wohnkomfort steigern.

Kaminofen Austauschpflicht: Fristen 2024 & Regelungen 2025
Ab Januar 2025 müssen Kaminöfen in Deutschland strengere Emissionsgrenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid einhalten. Der 31. Dezember 2024 markiert dabei einen entscheidenden Stichtag für Besitzer bestehender Anlagen: Je nach Baujahr und Zulassungsdatum des Kaminofens ist dann eine Stilllegung, technische Nachrüstung oder ein kompletter Austausch erforderlich, um den neuen Umweltstandards zu entsprechen. Erfahren Sie jetzt, welche Grenzwerte 2025 bei der Kaminofen Austauschpflicht gelten, welche Öfen Bestandsschutz genießen und daher von der Austauschpflicht ausgenommen sind.

F-Gase-Verordnung 2024: Was bedeutet das für Wärmepumpen?
Die novellierte F-Gas Verordnung (EU) 2024/573 markiert einen wichtigen Schritt in Richtung klimafreundlicherer Wärmetechnik. Sie gilt seit März 2024 für die Verwendung von F-Gasen oder fluorierten Treibhaugasen. Sie stellt eine Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 dar und hebt somit die Verordnung (EU) Nr. 517 aus dem Jahre 2014 auf. Die F-Gase-Verordnung 2024 hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen von F-Gasen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren, da im Gegensatz zu anderen Emissionen die F-Gase-Emissionen nicht abgenommen, sondern eher zugenommen haben. Gemäß des europäischen grünen Deals wurde 2019 eine neue Wachstumsstrategie für die EU vorgestellt – mit dem Ziel eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen, damit Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent (Null-Schadstoff-Kontinent) werden kann. Das kann nur erreicht werden, wenn die Emissionen von fluorierten Treibhausgasen drastisch gesenkt werden, was auch eine Auswirkungen auf den Markt für Wärmepumpen hat. Erfahren Sie in diesem Beitrag, welche Änderungen und Verbote die F-Gase-Verordnung 2024 für Wärmepumpen vorsieht.
