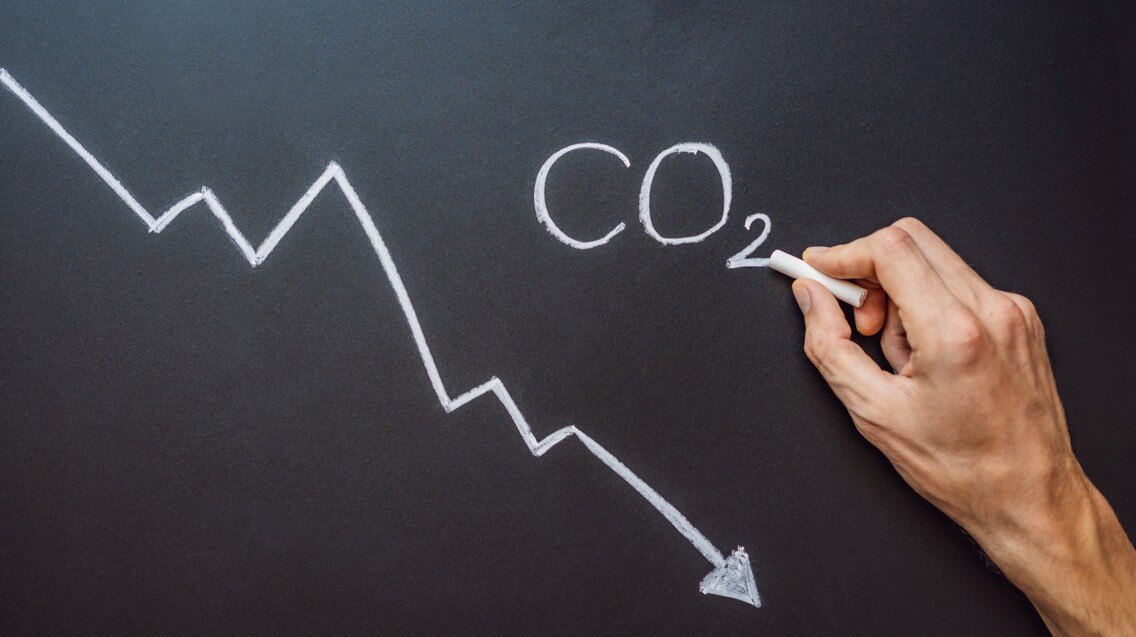
Gebäude als CO2-Senken zur Klimastabilisierung
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Ab 2050 sollen sogar negative Treibhausgasemissionen erzielt werden. Das bedeutet, dass langfristig mehr Kohlenstoffdioxid (CO₂) gespeichert wird, als in die Atmosphäre gelangt.
Während die Treibhausgasemissionen für Heizen, Kühlen und Beleuchten gesenkt wurden, steigen sie im Bausektor weiter an. Eine Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen und der Umstieg auf erneuerbare Energien allein reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Eine weitere globale Strategie zur Klimastabilisierung besteht darin, Kohlendioxid langfristig zu speichern, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Dabei bietet nicht nur der Industriesektor, sondern auch die Bauwirtschaft großes Potenzial, als sogenannte CO₂-Senke zu fungieren.
Inhalt:
Deutschlands Carbon-Management-Strategie: Ein Weg zur Klimaneutralität
Hohe Treibhausgasemissionen im Bausektor
Gebäude als Schlüssel zur Klimawende: Von CO₂-Quellen zu CO₂-Senken
Wie können Gebäude zu CO2-Senken werden?
CO₂-Speicherung in Zement: Wege zu einem klimafreundlichen Baustoff
CO₂-Speicherung in Beton mit Hilfe der CCS-Technologie
Vorteile der CO₂-Speicherung in Beton
Fazit: Gebäude als CO₂-Senken – Den Bausektor anders denken
Was sind CO2-Senken?
Natürliche oder künstliche Kohlenstoffsenken können mehr CO2 aufnehmen und langfristig speichern als sie abgeben. Damit verringert sich der Anstieg der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre, was zur Stabilität des Klimas beiträgt.
Natürliche CO₂-Senken
Wälder, Böden, Moore und Ozeane sind natürliche Kohlenstoffreservoire. Bäume und Pflanzen etwa nehmen CO₂ durch Photosynthese auf und speichern es in ihrer Biomasse. Ozeane absorbieren große Mengen CO₂, das zum Teil durch marine Organismen in organischen Materialien gebunden wird. Böden speichern Kohlenstoff durch abgestorbene Pflanzenreste und Mikroorganismen.
Durch menschliche Aktivitäten wie Entwaldung oder Bodenversiegelung werden natürliche CO2-Senken allerdings beeinträchtigt bzw. ihre Fähigkeit zur CO₂-Aufnahme wird verringert.
Künstliche CO₂-Senken
Diese basieren auf Technologien, die entwickelt wurden, um CO₂ gezielt aus der Atmosphäre zu entfernen. Dazu gehört u. a. das mittlerweile bekannte Verfahren Carbon Capture and Storage (CCS), bei dem CO₂ abgeschieden, komprimiert und u. a. in unterirdischen geologischen Formationen gespeichert wird.
Deutschlands Carbon-Management-Strategie: Ein Weg zur Klimaneutralität
Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine umfassende Carbon-Management-Strategie (CMS) beschlossen, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Die Strategie adressiert unvermeidbare CO₂-Emissionen in Industrien wie Zement, Kalk, Grundstoffchemie und Abfallverbrennung. Das Ziel ist es, diese Emissionen durch moderne Technologien wie Carbon Capture and Storage (CCS) und Carbon Capture and Utilization (CCU) einzufangen und entweder dauerhaft zu speichern oder weiterzuverwenden.
Hohe Treibhausgasemissionen im Bausektor
Die deutsche Bauwirtschaft ist ein bedeutender Verursacher von CO₂-Emissionen: Im Jahr 2024 wurden im Gebäudesektor etwa 101 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen freigesetzt, was rund 40 % der gesamten Emissionen in Deutschland entspricht. Hier spielen insbesondere energie- und CO2-intensive Materialien wie Zement und Beton eine große Rolle.
Die Treibhausgasemissionen durch Gebäude in Deutschland bis 2024
- Im Jahr 2024 verursachte der Gebäudesektor in Deutschland rund 101 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen und verfehlte damit das im Klimaschutzgesetz vorgegebene Ziel um etwa fünf Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente.
- Zwar konnte gegenüber dem Jahr 1990 ein Rückgang der Emissionen um rund 52,1 Prozentpunkte erzielt werden, doch reicht dieser Fortschritt nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen.
- Gemäß Klima-Zielpfad sollen die CO₂-Emissionen des Gebäudesektors bis zum Jahr 2030 auf etwa 65 Millionen Tonnen sinken. Bis zum Jahr 2045 wird angestrebt, den Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral zu machen.
(Quelle: Treibhausgas-Emissionen von Gebäuden bis 2024 | Statista, veröffentlicht von Statista Research Department.
Gebäude als Schlüssel zur Klimawende: Von CO₂-Quellen zu CO₂-Senken
In Deutschland entstehen rund 30 % der Treibhausgasemissionen durch die Nutzung von Energie in Gebäuden, während etwa 7 % bauwerksbedingt sind – verursacht durch Rohstoffaufbereitung, Werkstoffproduktion sowie der Errichtung von Gebäuden und Abfallentsorgung.
Um das Klima zu stabilisieren und die globalen Klimaziele zu erreichen, sind Negativemissionen notwendig, also Maßnahmen, die aktiv CO₂ aus der Atmosphäre entfernen. Gebäude können hierbei einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie CO₂-neutral betrieben und mithilfe von nachhaltigen und emissionsarmen Baumaterialien sowie innovativen Technologien errichtet wurden.
Wie können Gebäude zu CO2-Senken werden?
Ein zentraler Ansatz ist eine kreislaufgerechte Planung von Neubauten mit klimafreundlich hergestellten Materialien, recycelten und biobasierten Baustoffen wie Holz, Hanf oder Biomasse.
Als nachwachsender Rohstoff nimmt beispielsweise Holz während seines Wachstums CO₂ aus der Atmosphäre auf und speichert es langfristig. Ein Kubikmeter Holz kann etwa eine Tonne CO₂ speichern. Obwohl Holz ein guter Kohlenstoffspeicher ist, kann es energie- und emissionsintensive Materialien wie Zement, Beton und Stahl aber nur teilweise ersetzen.
CO₂-Speicherung in Zement: Wege zu einem klimafreundlichen Baustoff
Zement, der Hauptbestandteil von Beton, ist einer der größten Klimakiller im Bausektor. Bei der Herstellung von einer Tonne Zement entstehen im Durchschnitt 600 Kilogramm CO₂-Emissionen, da bei der Kalkstein-Kalzinierung chemisch gebundenes CO₂ freigesetzt wird. Damit entfallen in Deutschland rund 20 Millionen Tonnen CO₂ jährlich auf die Zementindustrie, was ca. 2 % der nationalen Emissionen entspricht.
Klimafreundlicher Zement und Beton
Die Herstellung klimafreundlichen Zements eröffnet neue Möglichkeiten, um den Bausektor nachhaltiger zu gestalten und aktiv zur Reduktion von Treibhausgasen beizutragen. Durch die Zugabe von Substanzen wie Calciumoxid und Magnesiumoxid wird der Zement in die Lage versetzt, Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen und dauerhaft zu speichern
Im Dezember 2024 wurde in Deutschland die weltweit erste industrielle CCU-Anlage (Carbon Capture and Utilization) für Zementwerke installiert. Diese Anlage scheidet CO₂ aus den emissionsintensiven Prozessen der Zementproduktion ab und bereitet es so auf, dass es für industrielle Anwendungen wie die Chemie- oder Lebensmittelindustrie genutzt werden kann.
Darüber hinaus ermöglicht die Technologie auch die Speicherung des abgeschiedenen CO₂ im Beton, wodurch es dauerhaft gebunden wird und zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks der Zementindustrie beiträgt.
Neben zahlreichen Forschungsprojekten zur klimafreundlichen Herstellung von Zement und Beton gibt es bereits markttaugliche Lösungen. Ein Beispiel für den Übergang von der Forschung in die Praxis ist ein Projekt der Bauhaus-Universität Weimar: Durch den Einsatz von Hochleistungsultraschall kann der Zementbedarf bei der Betonherstellung um 30 bis 40 % reduziert werden.
CO₂-Speicherung in Beton mit Hilfe der CCS-Technologie
Beton, eines der weltweit meistgenutzten Baumaterialien, bietet durch innovative Technologien die Möglichkeit, nicht nur CO₂-Emissionen zu reduzieren, sondern aktiv Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu speichern. Die Carbon Capture and Storage (CCS)-Technologie spielt dabei in der Zement- und Betonindustrie eine zentrale Rolle.
- CO₂-Bindung in Abbruchbeton: Die Mineralisierung von CO₂ in recyceltem Betongranulat ermöglicht es, CO₂ dauerhaft zu speichern und die Umweltbilanz von Recyclingbeton zu verbessern. Durch diesen Prozess können bis zu 10 – 15 Kilogramm CO₂ pro Tonne Abbruchbeton gebunden werden können.
- CO₂-Bindung in frischem Beton: Die gezielte Karbonisierung während der Herstellung von frischem Beton nutzt die chemische Reaktionen zwischen CO₂ und Calciumoxid im Zement, um Kalkstein zu bilden, was sowohl die Festigkeit als auch die Haltbarkeit des Betons erhöhen kann.
In Baden-Württemberg wurde die erste Pilotanlage zur Speicherung von CO₂ in ressourcenschonendem Beton (R-Beton) eröffnet. Das Unternehmen hat mit Unterstützung des Umweltministeriums eine innovative Technologie entwickelt, um Kohlenstoffdioxid dauerhaft in recycelter Gesteinskörnung zu binden. Diese Methode ermöglicht es, Altbeton aufzubereiten und mit CO₂ zu behandeln, wodurch sich auf der Oberfläche und in den Poren Kalkstein bildet. Das CO₂ wird dabei langfristig im Material gespeichert.
Für diesen Prozess wird abgeschiedenes CO₂ aus einer Biovergärungsanlage verwendet. Die so behandelten Gesteinskörnungen finden hauptsächlich in der Herstellung von R-Beton Verwendung, können jedoch auch für andere Zwecke genutzt werden. Mit der neuen Anlage können pro Jahr etwa 1.200 Tonnen CO₂ gespeichert werden, was einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität darstellt.
Biobasierte Baustoff-Forschung
Aktuell forscht das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS Verfahren, an biogenen Baustoffen auf Basis von Cyanobakterien (Blaugrünbakterien). Diese Materialien binden CO₂ und können für Dämmstoffe, Ziegel, Schalungsfüllungen und Mörtel verwendet werden. Das Projekt „BioCarboBeton“ zeigt das Potenzial biologisch induzierter Verfahren für eine nachhaltige Bauwirtschaft (Quelle: Biobeton und biogene Baumaterialien mit Cyanobakterien) .
Vorteile der CO₂-Speicherung in Beton
- Das gebundene CO₂ bleibt dauerhaft über Jahrhunderte im Material eingeschlossen.
- Einige Verfahren verbessern die Materialeigenschaften von Beton, wie die Festigkeit und ermöglichen gleichzeitig eine Reduktion des Zementanteils.
- Durch die Kombination von Emissionsreduktion und Kohlenstoffbindung wird Beton zu einer klimapositiven Kohlenstoffsenke.
Obwohl diese Technologien vielversprechend sind, stehen sie noch am Anfang einer breiten industriellen Anwendung. Herausforderungen wie hohe Energieanforderungen bei einigen Prozessen oder begrenzte Infrastruktur für die Kohlenstoffbindung müssen noch überwunden werden.
Fazit: Gebäude als CO₂-Senken – Den Bausektor anders denken
Gebäude als Kohlenstoffspeicher sind nicht nur ein Baustein für die Energiewende, sondern auch ein Symbol für eine zukunftsfähige Bauweise, die Ökologie und Ökonomie miteinander vereint. Neben der klimafreundlichen Herstellung von Zement und Beton und der Entwicklung neuer Technologien, um CO2 zu binden, liegt ein weiterer Hebel im Schließen des Materialkreislaufes.
Neubauten müssen bereits bei der Planung etwaige Wiederverwertungsmöglichkeiten berücksichtigen: Der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes – von der Rohstoffgewinnung über die Nutzung bis zur Entsorgung – ist entscheidend, um die Klimabilanz nachhaltig zu verbessern. Zusätzlich müssen biobasierte Materialien aus ihren Nischen geholt und in der Breite etabliert werden, um eine standardisierte, industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Zusätzlich braucht Deutschland klare politische Rahmenbedingungen wie etwa verpflichtende CO₂-Richtwerte für Neubauten, wie sie bereits in anderen EU-Ländern (wie etwa in Dänemark oder in den Niederlanden) existieren. Nur so kann der Gebäudesektor seine Rolle als CO₂-Senke voll entfalten und einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.
